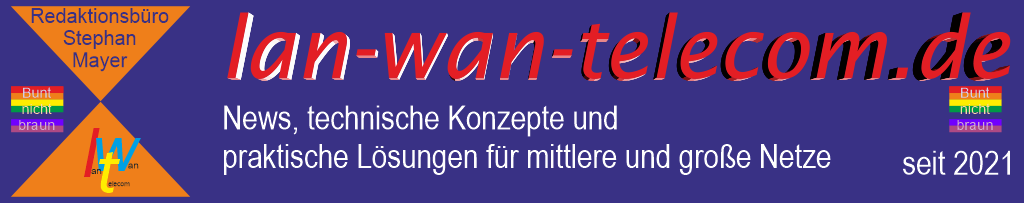In den vergangenen Jahren ist Deutschland bei Innovationen langsam, aber stetig zurückgefallen. Das zeigt sich unter anderem in verschiedenen Innovationsrankings, in denen die Bundesrepublik oft nur noch im Mittelfeld landet, sowie bei den öffentlichen und privaten Investitionen, die im internationalen Vergleich eher gering ausfallen. Insbesondere bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Software hinkt Deutschland weit hinter anderen europäischen Staaten und den USA hinterher. Angesichts des Potenzials, das digitale Technologien wie KI für eigentlich alle Unternehmen und Branchen bieten, sind das für die Zukunft keine guten Aussichten.
Gründe für den nachlassenden deutschen Erfindergeist gibt es viele – angefangen bei einer Flut von regulatorischen Vorschriften und langwierigen Genehmigungsprozessen, die viele Innovationsprojekte ausbremsen, bis hin zum Fachkräftemangel und der schleppenden Digitalisierung der öffentlichen Infrastrukturen und Verwaltungen. Meiner Erfahrung nach werden diese Gründe aber auch gerne als Ausrede benutzt, um Veränderungen und Risiken zu vermeiden. Viele Unternehmen haben es sich bequem gemacht und sind eher daran interessiert, den Status quo zu bewahren, als neue Angebote und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das gilt für die hiesige Automobilbranche, die vor allem bei der Elektromobilität an Boden auf die chinesische Konkurrenz verliert, ebenso wie für den Onlinehandel, der durch die Branchengrößen aus den USA und China unter immer größerem Druck steht.
Ein Stück weit hat das sicher mit dem deutschen Perfektionismus zu tun. Man sieht vor allem die Probleme und nicht die Chancen, verliert sich zu schnell in Details und betrachtet Fehler als Makel, anstatt aus ihnen zu lernen. Die Folge: Deutschland ist bei den europäischen Patentanmeldungen zwar noch die Nummer zwei, doch bei vielen Patenten handelt es sich lediglich um Verbesserungen bestehender Produkte, Verfahren und Technologien, sprich: deren Perfektionierung. Zu selten entstehen völlig neue Entwicklungen, da diese schon von Anfang so perfekt wie möglich sein sollen. Dass das gar nicht notwendig ist, zeigen etwa die großen Software- und Internet-Konzerne aus den USA immer wieder, die sich nicht scheuen, etwas auszuprobieren – die Experimente aber auch abbrechen beziehungsweise Angebote wieder vom Markt nehmen, wenn sie nicht den gewünschten Erfolg haben.
Diesen Mut wünsche ich mir auch von deutschen Unternehmen: dass sie neue Dinge versuchen, ihren Mitarbeitern dafür Freiräume bieten und Fehlschläge akzeptieren. Die Erfahrungen, die sie dabei machen, sind wertvoll für die nächsten Projekte, die dann viel wahrscheinlicher erfolgreich sind. Zudem sind sie ja nicht auf sich allein gestellt, sondern können spezialisierte Partner hinzuziehen, die sich mit KI auskennen und die Entwicklung innovativer Hardware- und Software-Lösungen von Ende zu Ende begleiten – von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur Markteinführung und Produktpflege. Die Partner sollten allerdings auch das Geschäftsmodell des Unternehmens und die Branche verstehen, also wie sich Kundenanforderungen verändern und in welchen Bereichen sich zukünftig Geld verdienen lässt.
Letztlich sind Innovationen ein Teamsport, bei dem verschiedene Perspektiven und Fähigkeiten die Erfolgschancen signifikant erhöhen. Nur den Mut – den kann man nicht einkaufen, man muss ihn schon selbst aufbringen.
Sebastian Seutter, Managing Partner DACH bei HTEC (Quelle: HTEC)