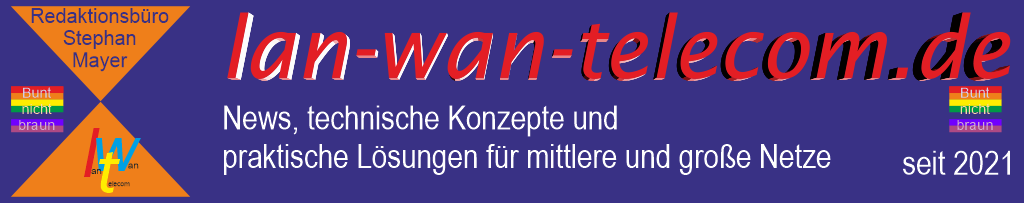Mit einem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen will die neue Bundesregierung die öffentlichen Infrastrukturen stärken. Noch ist zwar weitgehend unklar, wie viel davon in die Digitalisierung des Landes fließen wird – womöglich ist es aber mehr als gedacht. Denn selbst wenn der Löwenanteil für Straßen, Schienen, Brücken, Energienetze sowie Schulen und Krankenhäuser aufgewendet werden sollte, so sind Digitalisierung und KI auch in diesen Bereichen die Treiber von Innovationen. Viel wichtiger als Diskussionen um konkrete Summen ist daher, dass das Geld nicht mit der Gießkanne verteilt wird und damit wirkungslos versickert. Notwendig sind strategische und eben sehr gezielte Digitalinvestitionen, die möglichst weiten Teilen der Wirtschaft und Gesellschaft nutzen.
Bei der Identifizierung der entsprechenden Bereiche sollte die Regierung unbedingt externe Experten und Vertreter von Wirtschaft und Bevölkerung einbinden. Nur so kann sie verschiedene Blickwinkel und Interessen abwägen und klare Investitionsziele setzen. Zu diesen sollte sicher der weitere Ausbau von Breitband- und Mobilfunknetzen zählen, die für die digitale Teilhabe wichtig sind, sowie die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die bislang noch nicht richtig in Schwung gekommen ist. Auch Gesundheits- und Bildungswesen könnten eine weitere Finanzspritze gut vertragen, damit ihre Digitalisierung weniger stark von der eigenen Finanzkraft beziehungsweise der der jeweiligen Kommunen abhängt.
Ganz entscheidend für die digitale Zukunft Deutschlands sind darüber hinaus Investitionen in leistungsfähige KI-Infrastrukturen – idealerweise nicht allein durch den Staat, sondern in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in Public-Private-Partnerships. Diese KI-Infrastrukturen könnten vielen Behörden, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Unternehmen jeder Größe und Branche dabei helfen, das Potenzial von KI zu erschließen, ohne die hohen Investitionen in eigene Hochleistungssysteme stemmen zu müssen – was sich viele gar nicht leisten können und für deren Verwaltung häufig die Ressourcen fehlen.
Diese KI-Infrastrukturen müssen allerdings nicht nur allen offenstehen, sie sollten auch auf offenen Architekturen und Plattformen basieren, um Abhängigkeiten zu vermeiden und Interoperabilität langfristig sicherzustellen. Überdies könnten KI-Modelle, Daten und Anwendungen dann leichter einrichtungs-, unternehmens- und branchenübergreifend genutzt werden. Parallel dazu sind Investitionen in Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramme notwendig, um die digitalen Kompetenzen im Allgemeinen und die KI-Fähigkeiten im Speziellen auszubauen.
Damit die Investitionen schnell Wirkung zeigen können, müssen aber auch noch bestehende strukturelle Hürden abgebaut werden, insbesondere die bürokratischer Art. Natürlich geht es nicht darum, alle Regeln und Auflagen zu schleifen, denn es braucht Kontrollmechanismen, um Fehlinvestitionen oder ein Ausnutzen des Staats zu verhindern – gerade, wenn öffentliche Gelder in einem solchen Umfang verteilt werden. Doch schlankere Vergabe- und Genehmigungsverfahren würden – ebenso wie mehr und bessere digitale Prozesse in der öffentlichen Verwaltung – nicht nur den Einsatz des Sondervermögens erleichtern, sondern die Wirtschaft insgesamt bei Investitionsvorhaben unterstützen.
Letztlich bietet sich mit dem Sondervermögen eine einmalige Gelegenheit, unser Land für die Zukunft und kommende Herausforderungen zu rüsten – auch und vor allem in digitaler Hinsicht. Es ist so etwas wie eine Sonderchance, unseren Digitalrückstand aufzuholen und ein fortschrittliches Deutschland zu gestalten.
Kommentar von Tim van Wasen, Managing Director DACH bei Dell Technologies